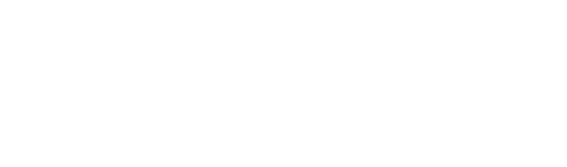Die Sektion hat sich mit Transgender-Kino einen Namen gemacht und vergibt seit 1987 den „Teddy Award“, den queeren Filmpreis der Berlinale. Wir besprechen drei sehr persönliche Dokumentarfilme, bei denen es um Familie und Zusammenhalt geht.
Minderheit Transgender: „North By Current“
Der Film des Multimediakünstlers Angelo Madsen Minax beginnt mit unscharfen Videoaufnahmen aus den 1980er Jahren. Es sind typische Familienaufnahmen, die sich durch den ganzen Film ziehen werden. Das passt sehr gut, denn der Regisseur begibt sich auf eine sehr private Spurensuche zum Verhältnis zu seiner Familie.
Kinder als Lebensziel
Bezeichnend ist ein Besuch in einem Diner, in dem sich die Eltern, seine Schwester Jesse und er anschweigen. Sie haben sich auseinandergelebt. Im Hintergrund läuft ein Song über den Verlust eines Kindes. Dies ist sehr symbolisch, denn Jesse hat vor drei Jahren ihre zweijährige Tochter Kalla verloren. Dadurch, dass der Regisseur transgender ist, ist auch er für die Familie verloren, da sie strenge Mormonen sind. Für den Vater, der ein Sägewerk betreibt, ist die Reproduktion der Familie der eigentliche Sinn des Lebens. Der Regisseur hat überhaupt keine Kinder.


Vom Verlust einer Tochter
Vier Jahre fährt er nun mit seiner Kamera in die Kleinstadt in Michigan, um herauszufinden, warum Kalla sterben musste. Aber ebenso wichtig ist es ihm, das Verhältnis zu seinen Eltern und seiner Schwester zu klären. Die Behörden gaben Jesse und ihrem Mann eine Schuld am Tod der Tochter, stellten das Verfahren jedoch ein. Trotzdem wurden sie im Ort als Kindermörder gebrandmarkt.
Getrübte Familien-Idylle
Jesse verfällt in Depression und bekommt trotzdem jedes Jahr ein neues Baby. Doch dies ist keine Lösung. Sie hat einen Zusammenbruch. Sie trennt sich von ihrem Mann und zieht mit den Kindern zu ihren Eltern. So richtig sprechen will sie über ihre Probleme nicht. Man sieht ihr bei den verschiedenen Besuchen regelrecht an, wie schlecht es ihr geht. Zumindest die Mutter ist bereit, sich mit ihrem Sohn zu versöhnen. Aber so richtig nahe kommen sie sich nicht mehr.
Minderheit Obdachlose: „Dirty Feathers“
Die Obdachlosen im amerikanischen El Paso stehen im Mittelpunkt dieses in starken Schwarzweißbildern gedrehten Dokumentarfilms von Carlos Alfonso Corral. Sie werden ernst genommen, können ihre Geschichten, ihre Vergangenheit und Perspektiven erzählen. Das Team hört ihnen zu, ist nah dran und bietet den von der Gesellschaft Ausgestoßenen eine Stimme. Nachts schlafen viele von ihnen in dem selbstverwalteten „Opportunity Center for the Homeless“, unter Vordächern von Einkaufszentren oder in Wind geschützten Hauseingängen.

Keine übliche Sozialreportage
Der Regisseur Carlos Alfonso Corral ist in diesem Grenzgebiet zwischen Mexiko und Texas geboren, aufgewachsen und arbeitete zunächst als Fotograf. Die Bildgestaltung überließ er bei seinem Langfilmdebüt Nini Blanco, der überzeugende Bilder liefert, die sich stark von den üblichen Sozialreportagen unterscheiden.
Hoffnung auf bessere Zukunft
Neben der Ästhetik spielt die Musik eine wichtige Rolle in „Dirty Feathers“. Auf einen einordnenden Kommentar verzichtet Corral ganz und lässt seine Protagonisten für sich sprechen. Im Mittelpunkt steht ein Paar, das ein Kind erwartet. Dabei wird bei vielen deutlich ihre feste Verbundenheit mit dem Glauben und der Hoffnung, dass sich ihr Leben noch zum Besseren ändern kann.
Minderheit Yanomami: „The Last Forest“
Um den indigenen Stamm der Yanomami geht es in dem Film „The Last Forest“ von Luiz Bolognese, der zusammen mit dem Häuptling Davi Kapenawa Yanomami entwickelt wurde. Der Stamm lebt seit über 1.000 Jahren im brasilianisch-venezolanischen Grenzgebiet, 500 Jahre bevor diese Länder überhaupt gegründet wurden.
Der exotische Alltag im Regenwald
Der Film zeigt ihren Alltag, ihre Riten und Mythen in aufwändig gedrehten Bildern, die die besondere Farbigkeit hervorheben und zum Teil inszeniert sind. Ziel ist das Leben des Stammes und ihre Traditionen aus ihrer Perspektive mit durchaus ethnografischem Interesse zu erzählen. Der Stamm steht wie eine Familie zusammen.


Goldsucher vergiften Flüsse
Denn ihre Existenz ist einmal mehr gefährdet. Schon 1986 kamen 45.000 Goldsucher in ihr Gebiet, verseuchten die Flüsse mit Quecksilber, mit denen das Gold getrennt wird, und brachten Krankheiten. Bis zu 2.000 der Indigenen starben. 1992 sprach ihnen die brasilianische Regierung die Landrechte zu. Nach einem weiteren Massaker von Goldsuchern wurden die Gesetze verschärft und sie hatten 25 Jahre ihre Ruhe. Unter der Regierung Bolsonaro wurden 2019 die Einschränkungen gelockert und wieder kommen Goldsucher in das Gebiet mit ähnlichen Auswirkungen. Sie steckten die Völker sogar mit Corona an.
Kampf um ihr Land
Jetzt muss der Häuptling gegen die bösen Geister kämpfen, ob mit traditionellen Riten, auf politischer Ebene oder in dem er die Welt mobilisiert. Er zählt zu den wichtigsten Sprechern der Yanomami und der Film zeigt ihn bei einem Vortrag an der renommierten Havard Universität. Seine Stimme wird gehört und dieses Ziel hat auch der Film.