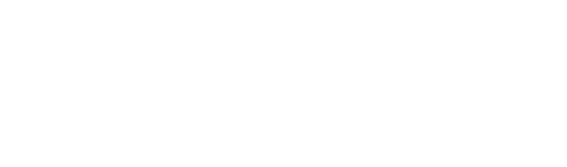Kurz vor Inkrafttreten des „Lockdown light“, der erneut alle Kinosäle zur Schließung gezwungen hat, ist DOK Leipzig zu Ende gegangen. Dieses fand 2020 erstmals zweigleisig – online und vor Ort – statt. Ein Interview mit Festival-Chef Christoph Terhechte.
Doku-Festivals spiegeln digitalen Wandel
Das DOK München @home hat es als erster deutscher „Big Player“ vorgemacht. Andere Festivals für Dokumentar- und/oder Animationsfilm zogen in Folge nach – beziehungsweise ebenfalls ins Virtuelle um. Der digitale Raum als Plattform für Filme und ihre Macher*innen ist im Corona-Jahr 2020 nicht mehr wegzudenken, wird aber auch rege in der Branche diskutiert. Wohin könnte die Reise gehen? Wie können gerechte Verwertungsmodelle für alle Beteiligten aussehen? Wie plant man für eine mögliche Zeit nach dem Ende der Pandemie?
DOK Leipzig-Chef Christoph Terhechte im HDF-Interview
Christoph Terhechte, seit Januar Leiter von DOK Leipzig, hat gerade seine Festival-Premiere in der sächsischen Metropole erfolgreich gemeistert. Im Interview mit Elisa Reznicek vom Haus des Dokumentarfilms spricht er über die Herausforderungen dieser besonderen Hybrid-Ausgabe sowie mögliche Perspektiven und Wünsche für die Zukunft. „Es waren gerade die Dokumentarfilmfestivals, die in beeindruckender Zeit von Präsenzveranstaltungen auf online umgeschaltet haben – selbstverständlich mit Unterstützung der gesamten Branche“, ist sich Terhechte sicher, während er betont, dass „Plattformen, die eine Alternative zu Netflix darstellen und sich auf den Dokumentarfilm konzentrieren“ ein echter Gewinn auch im Alltag sein könnten. Es heißt also dranbleiben am Digitalen, oder?

Elisa Reznicek: Man wächst mit seinen Aufgaben, sagt man. Welche Learnings und Erfahrungswerte nehmen Sie aus Ihrem ersten DOK Leipzig – und das im Corona-Jahr – mit?
Christoph Terhechte: Man darf den Aufwand und die Belastung nicht unterschätzen, den grundlegende Umstrukturierungen für eine Organisation und ihre Mitarbeiter*innen bedeutet. Die Reorganisation von DOK Leipzig als Hybridfestival hat ein Jahr äußerst anstrengender Umbauten und Umdenkens bedeutet. Wir hätten deutlich mehr Zeit gebraucht, um das alles stressfrei zu bewältigen. Ohne ein höchst motiviertes Team wären wir wohl kaum am Ziel angekommen. Ich kann nur hoffen, dass das Geleistete uns helfen wird, im kommenden Jahr auf den Erfahrungen von 2020 aufzubauen. Schließlich wissen wir nicht, unter welchen Umständen das nächste Festival stattfinden kann.
Elisa Reznicek: Muss die Dokumentarfilmbranche digitaler werden?
Christoph Terhechte: Das ist sie längst. Es waren gerade die Dokumentarfilmfestivals, die in beeindruckender Zeit von Präsenzveranstaltungen auf online umgeschaltet haben – selbstverständlich mit Unterstützung der gesamten Branche. Die Filmschaffenden haben uns und andere Festivals darin bestärkt und mit ihrer Online-Teilnahme bereichert. An mangelndem Willen liegt es gewiss nicht. Was wir brauchen, sind Plattformen, die auch im Alltag eine Alternative zu Netflix darstellen und sich auf den Dokumentarfilm konzentrieren. Da sind neue Geschäftsmodelle gefragt, eine Art Bandcamp für Filmschaffende etwa.
Elisa Reznicek: Wie wurde das DOK Leipzig in seiner hybriden Form vom Publikum, Branchenvertretern und Fachleuten angenommen?
Christoph Terhechte: Wir hatten nur positives Feedback, wenn man von einigen Pannen absieht, die beim Kartenverkauf für das Streaming passiert sind. Noch steht die Auswertung der Zahlen aus, denn das Ticketing lag in diesem Jahr bei unseren Kino- und Streaming-Partnern. Gefreut hat uns aber, dass die Rückmeldungen das Festival-Feeling betonen, das auch in der digitalen Edition vermittelt wurde. Die Filmschaffenden haben sich durch Gesprächsrunden, Live-Q&As, eigens für uns erstellte kurze Videos und natürlich die Teilnahme in allen Industry-Angeboten intensiv an DOK Leipzig beteiligt.
Elisa Reznicek: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Welche beiden Filme haben Sie am meisten berührt?
Christoph Terhechte: Der nigerianische Dokumentarfilm „Trouble Sleep“ von Alain Kassanda hat sich schon bei den Sichtungen als mein diesjährige Lieblingsfilm erwiesen. Eine 40-minütige Ode an das Leben in der Großstadt Ibadan, derart rhythmisch inszeniert und montiert, dass ich auch ohne die Filmmusik nur den Vergleich zu mitreißendem Jazz ziehen kann.
Auch Jim Finns „The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant” ist mit 61 Minuten ein eher kurzes Werk, aber so reichhaltig, dass ich ihn mit Vergnügen bereits dreimal gesehen habe. Die originelle Art und Weise, in der er sich dem amerikanischen Bürgerkrieg nähert, macht der Zuschauer*in auch die Gegenwart begreiflicher. Die Tatsache, dass er auf 16mm-Filmmaterial gedreht ist, trägt gewiss zu seiner Schönheit bei.
>> zum Filmgespräch mit Jim Finn über „The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant”
>> zum „Director’s Short Cut“ des Filmemachers